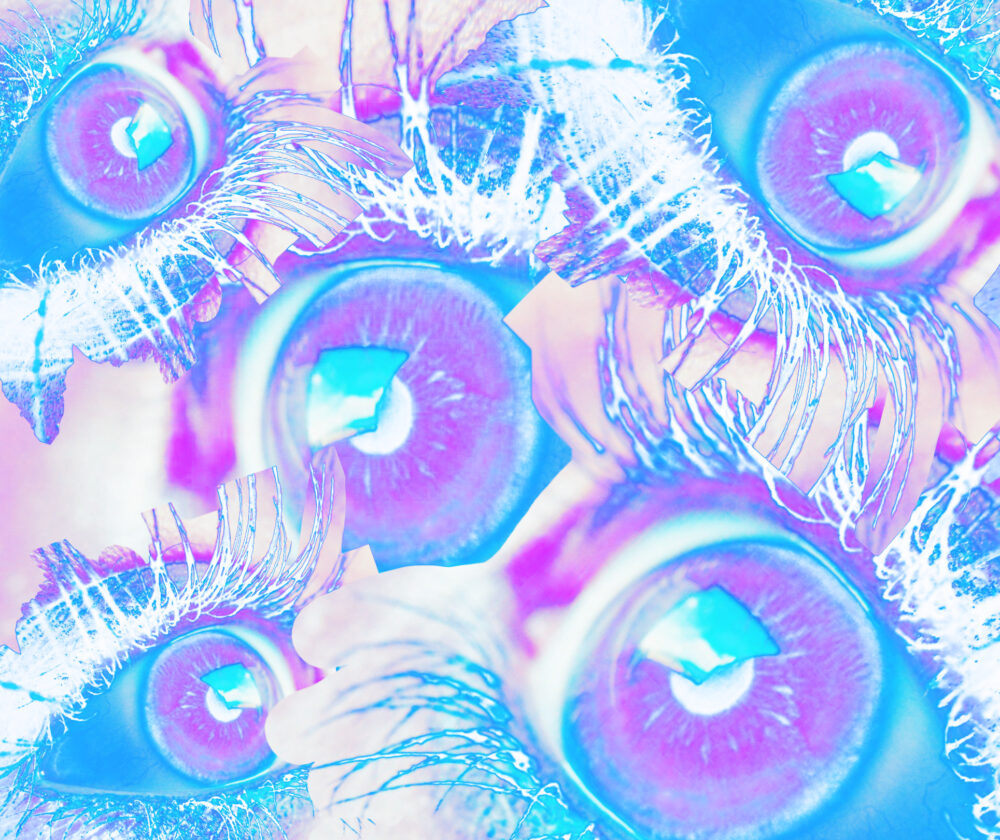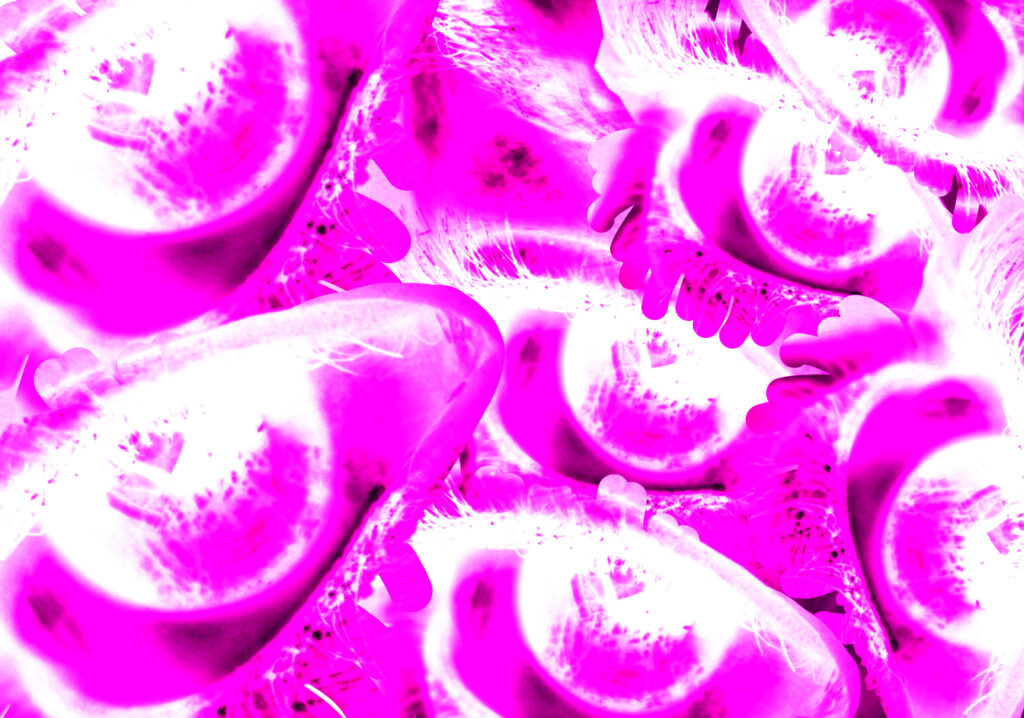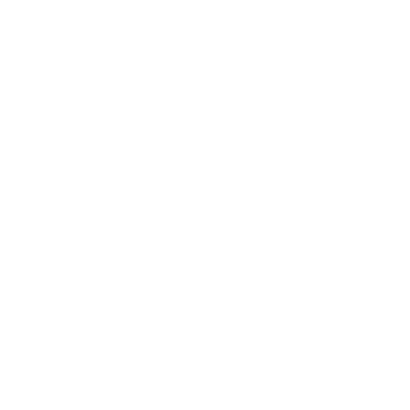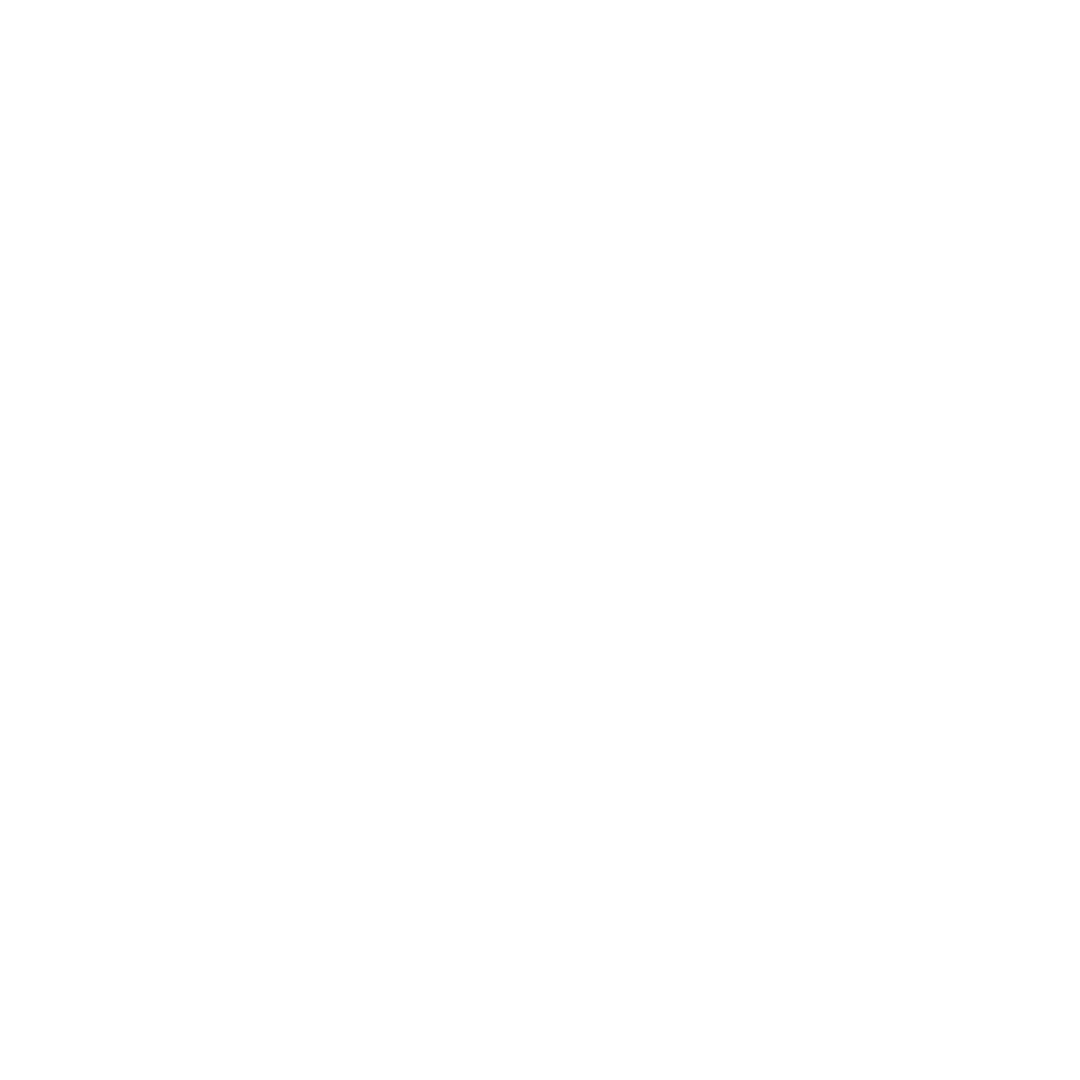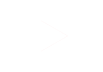Vor etwa fünfzehn Jahren habe ich mich in das Internet eingeloggt. Damals waren digitale Räume vor allem Räume der Anonymität. Das Internet war noch jung, die Grafikdarstellung war grottig, die regionalen Chatrooms fungierten als Vorreiter von Social Media Kanälen.
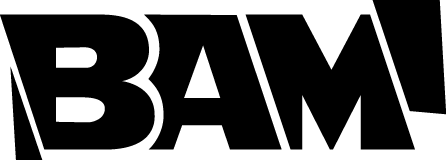
Wir brauchen deine Zustimmung
BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?
Cookie-Einstellungen
Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Alle auswählen
Betriebsbedingt notwendige Cookies
Statistik-Cookiesv
Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv