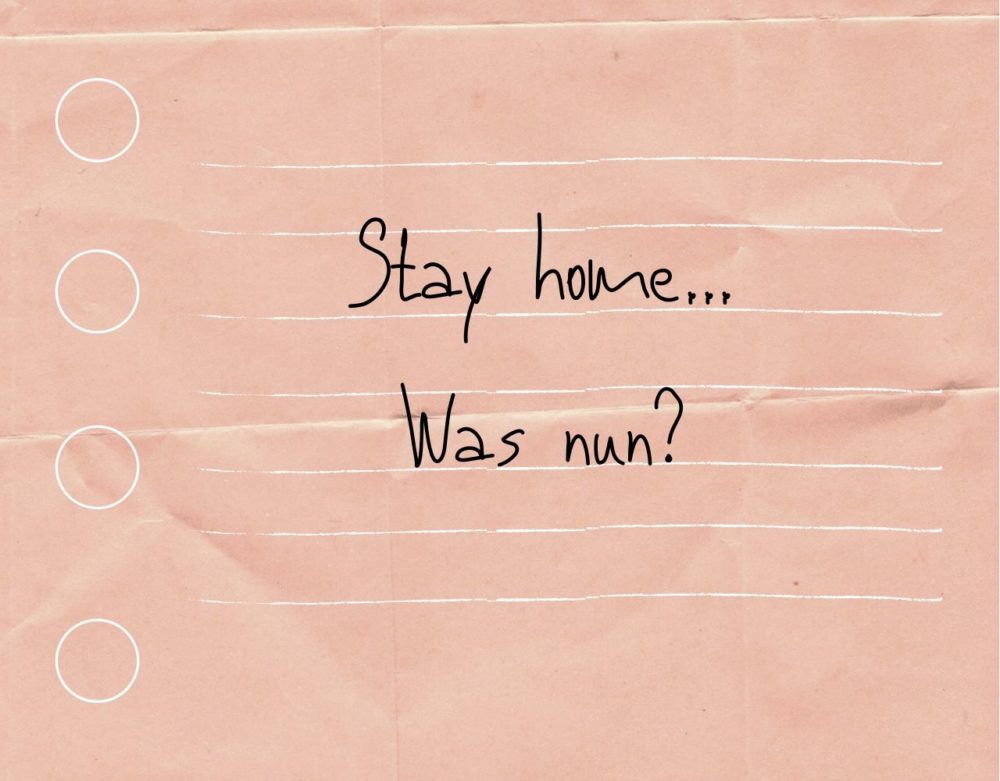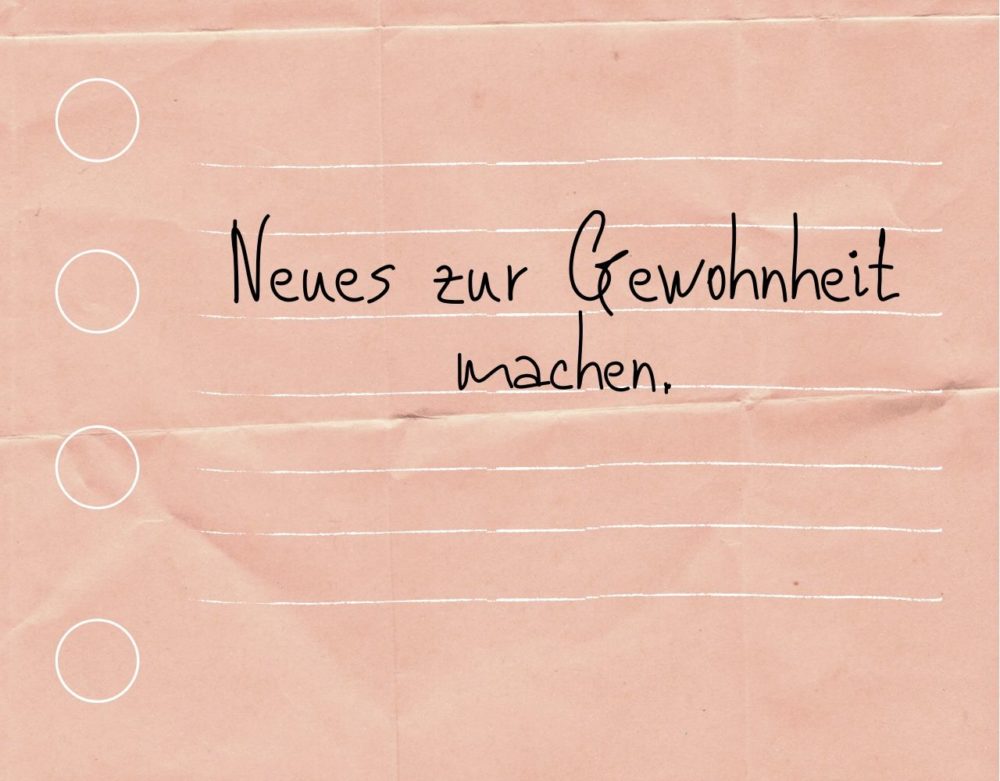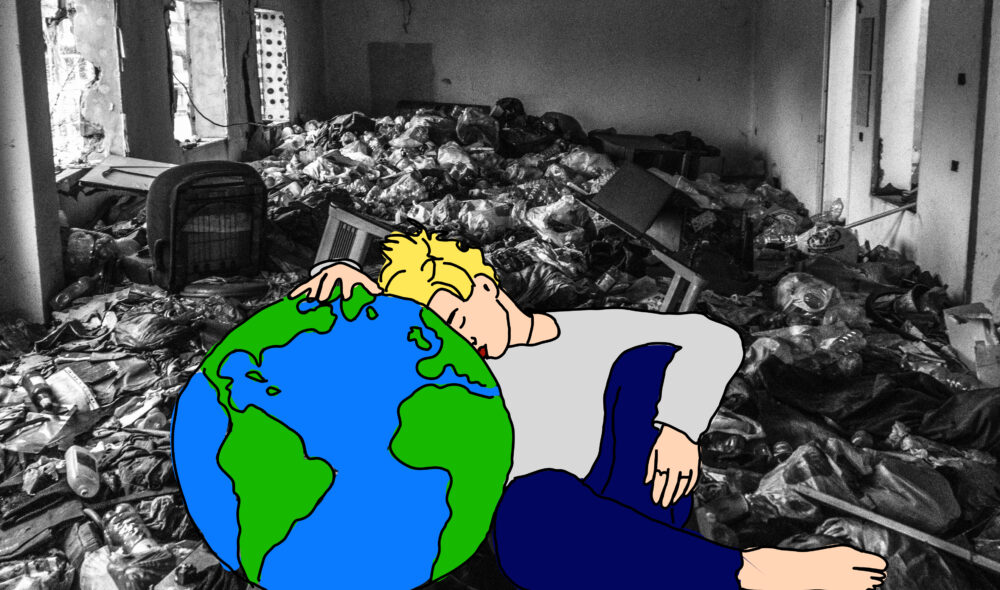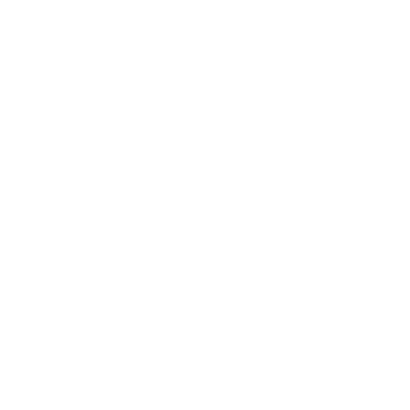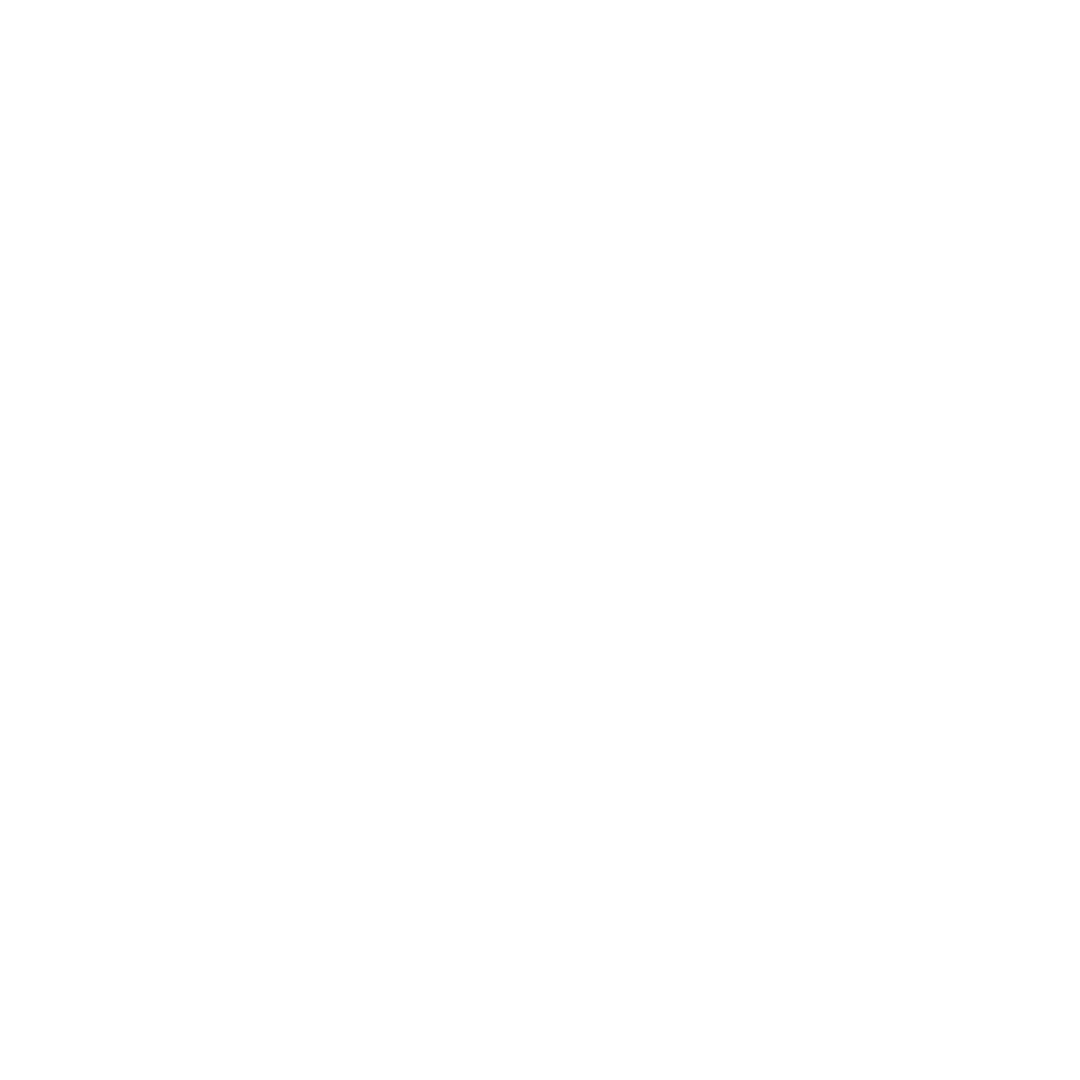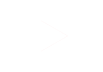Klopapier ist das heiß begehrteste Ding im Supermarkt, Masken sind Gewohnheitssache und eineinhalb Meter sind viel mehr als man eigentlich denkt. Das sind wohl die offensichtlichsten Dinge, die ich während der Ausgangssperre gelernt habe. Etwas, das ein bisschen tiefer geht und mich immer noch nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass ich die letzten Wochen gemerkt habe, dass ich mit viel weniger auskomme als ich glaubte, vor allem, wenn es wirklich darauf ankommt.
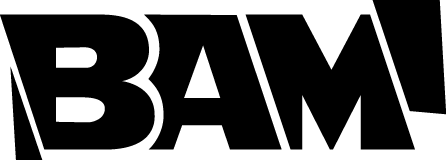
Wir brauchen deine Zustimmung
BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?
Cookie-Einstellungen
Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Alle auswählen
Betriebsbedingt notwendige Cookies
Statistik-Cookiesv
Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv