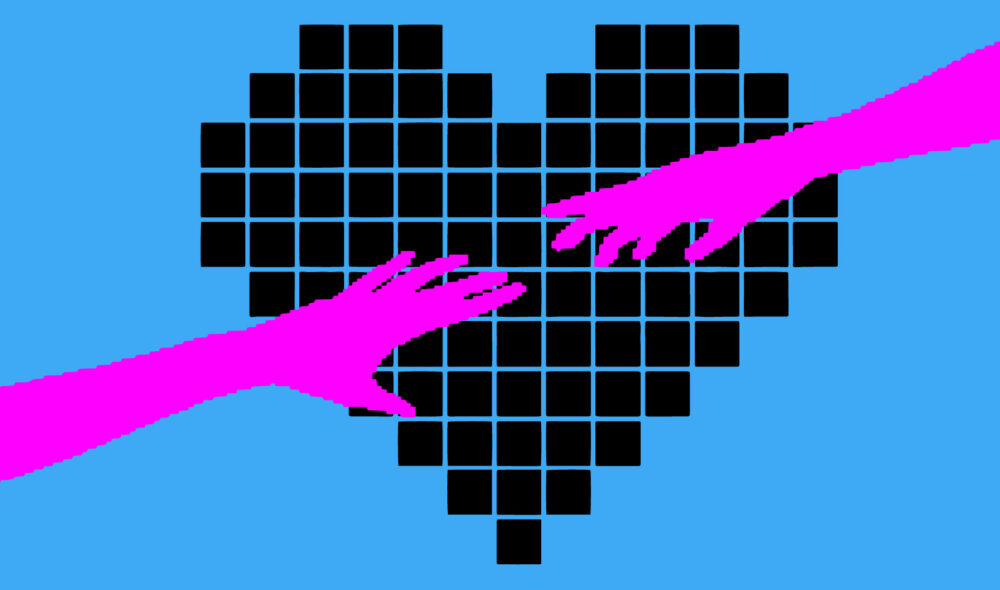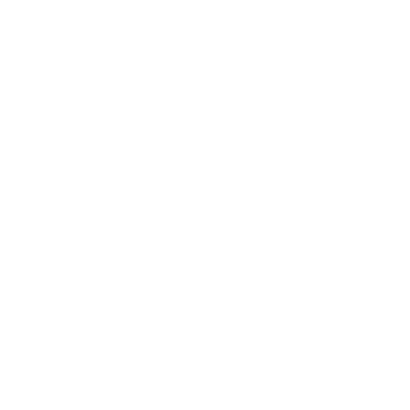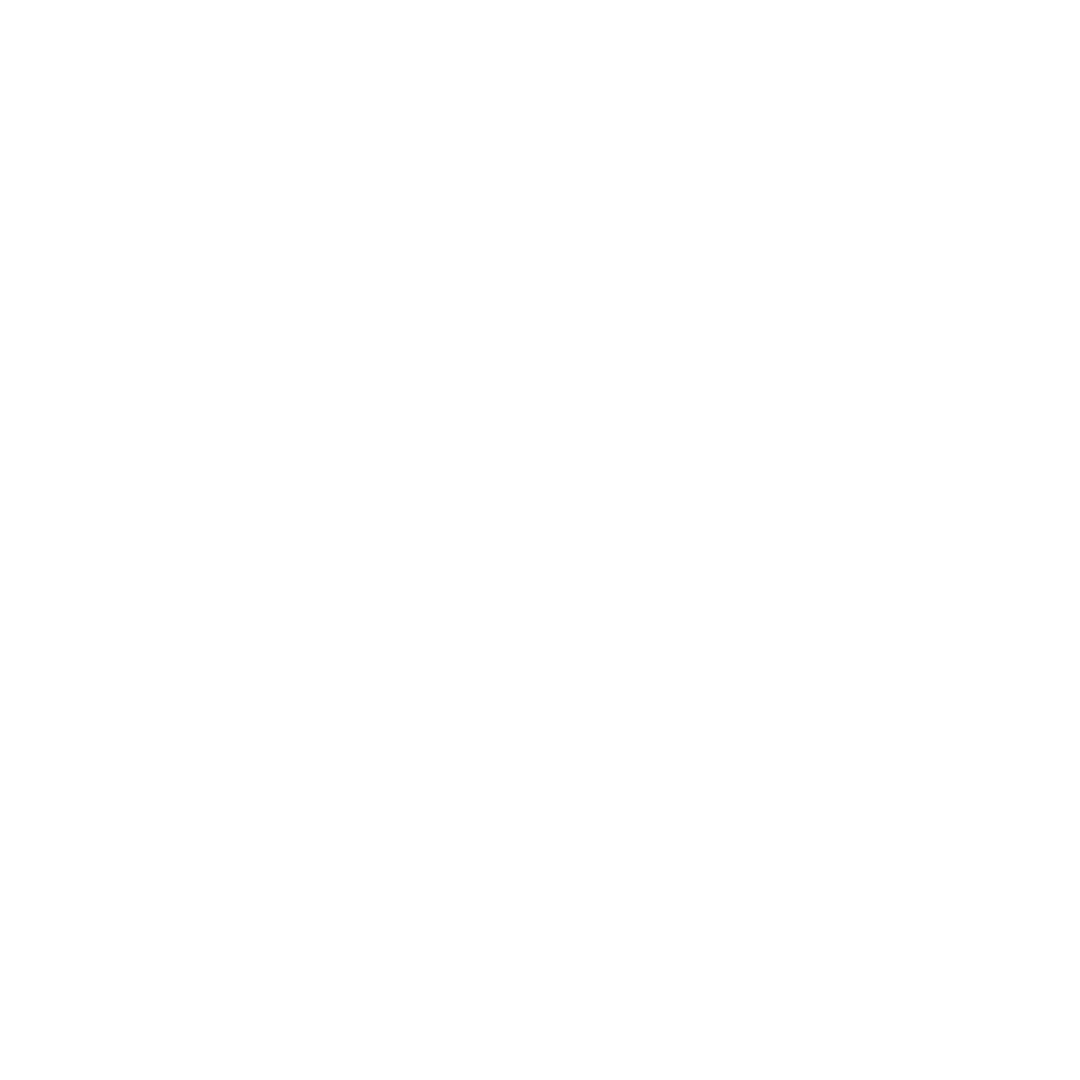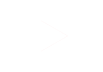Diesen Text schreibe ich, als ich am Rande eines 260 Seelendorfes in einem Haus ohne stabilem Mobilfunknetz sitze. Während mir hier bisher mehr Schafe als Menschen begegnet sind, konfrontiere ich mich immer wieder damit, was von mir übrig bleibt, wenn der Lärm der Stadt abklingt.
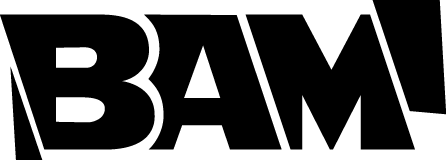
Wir brauchen deine Zustimmung
BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?
Cookie-Einstellungen
Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Alle auswählen
Betriebsbedingt notwendige Cookies
Statistik-Cookiesv
Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv