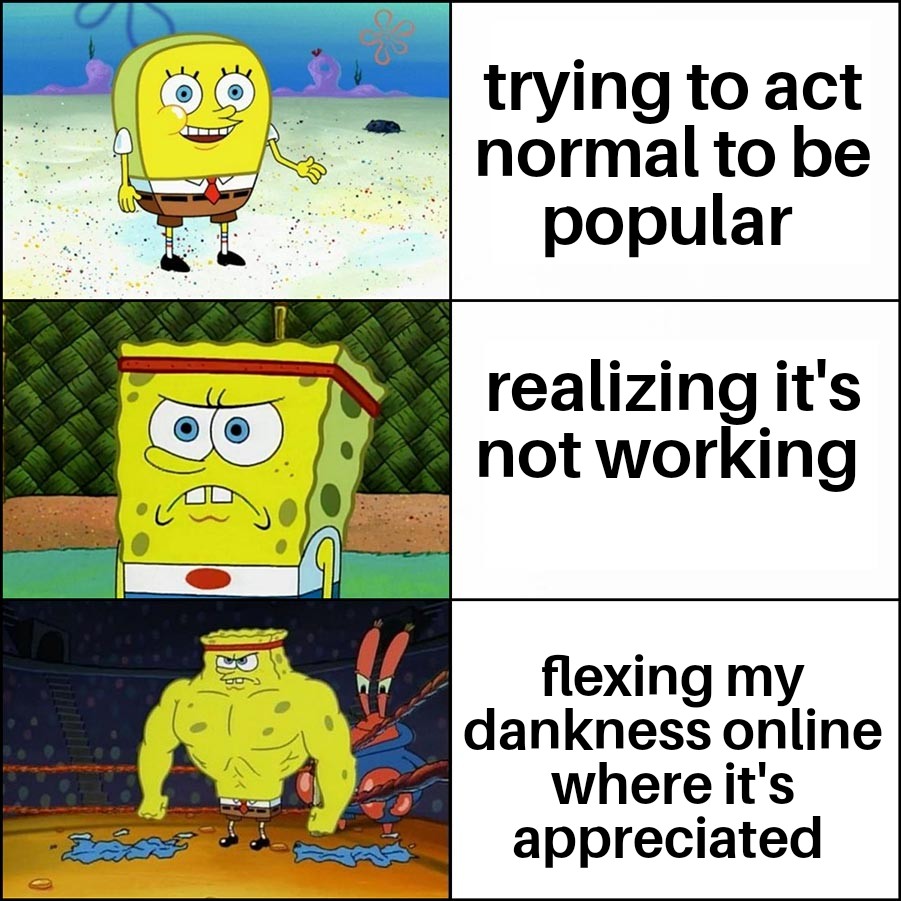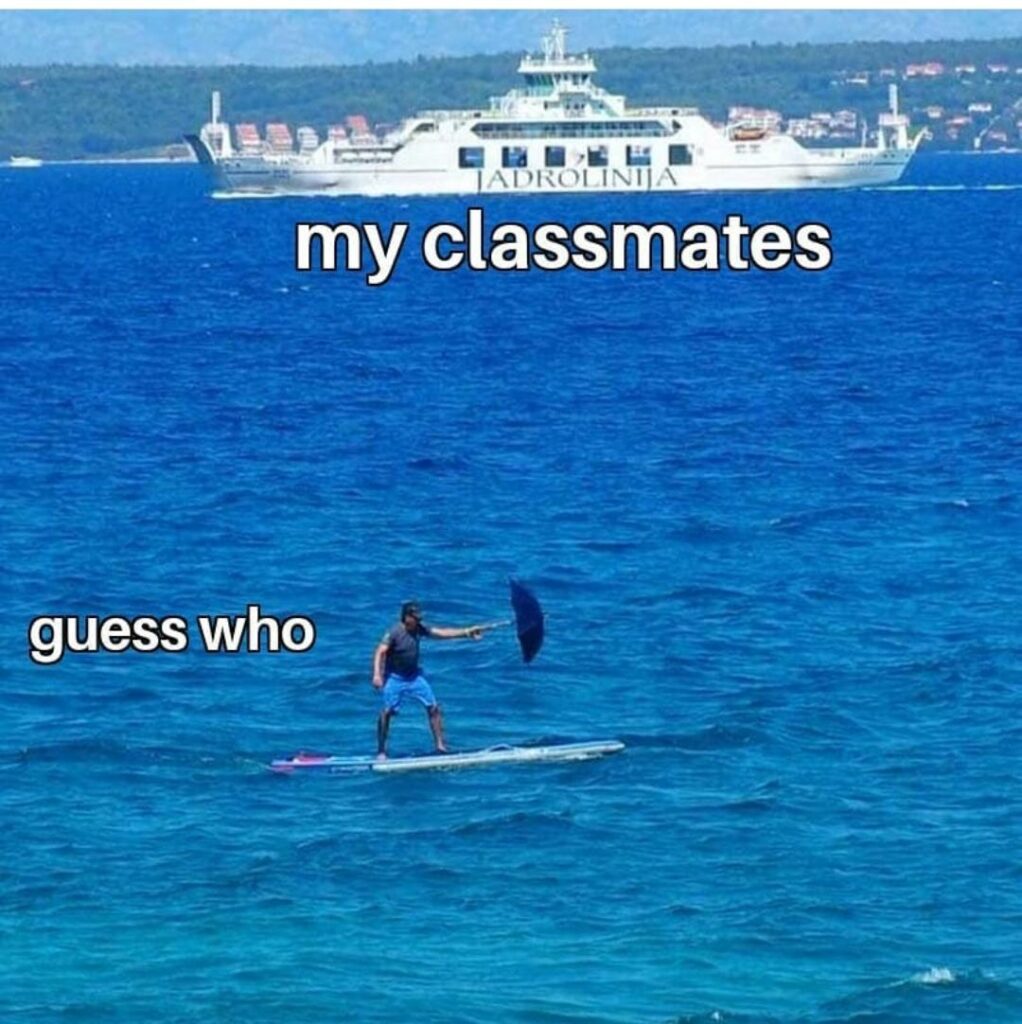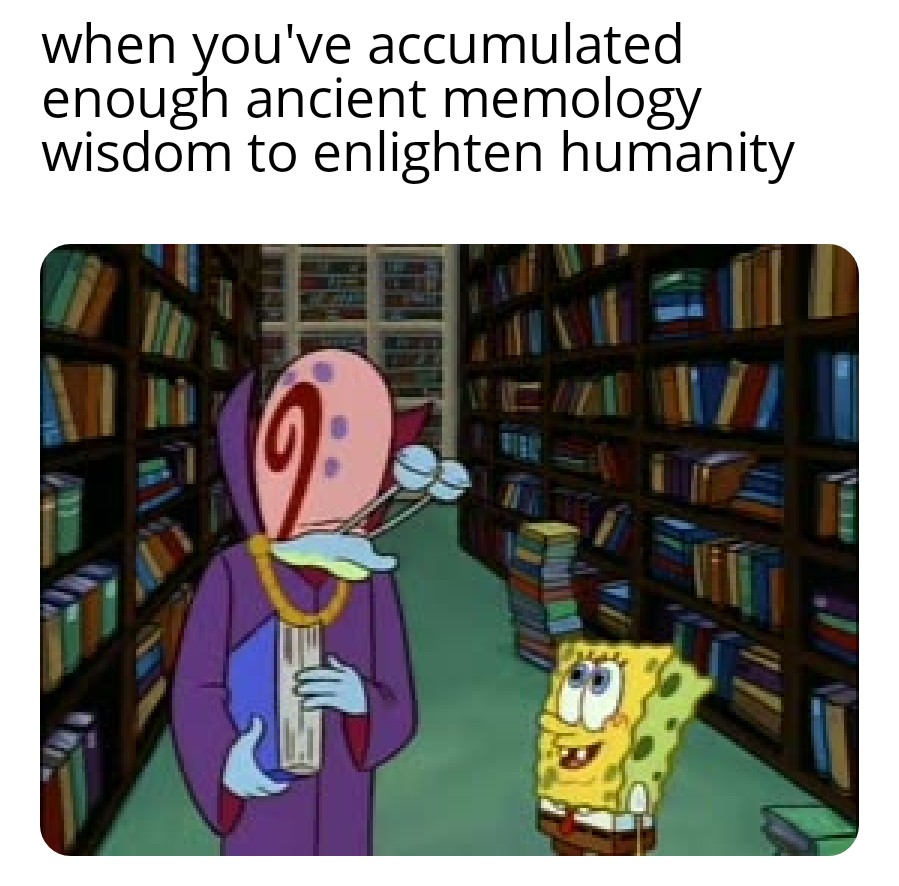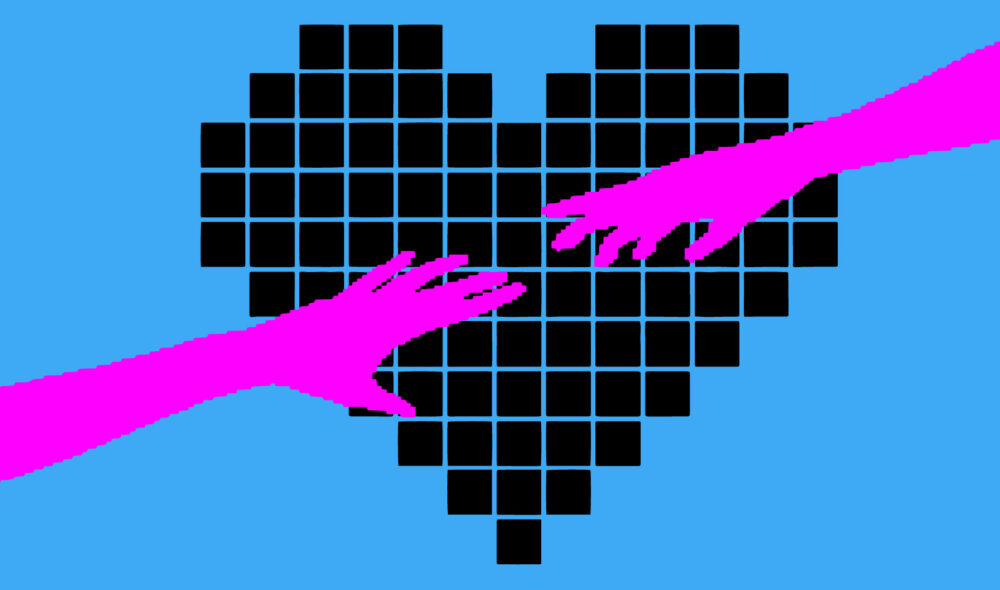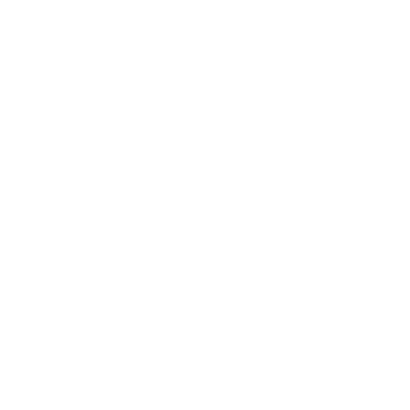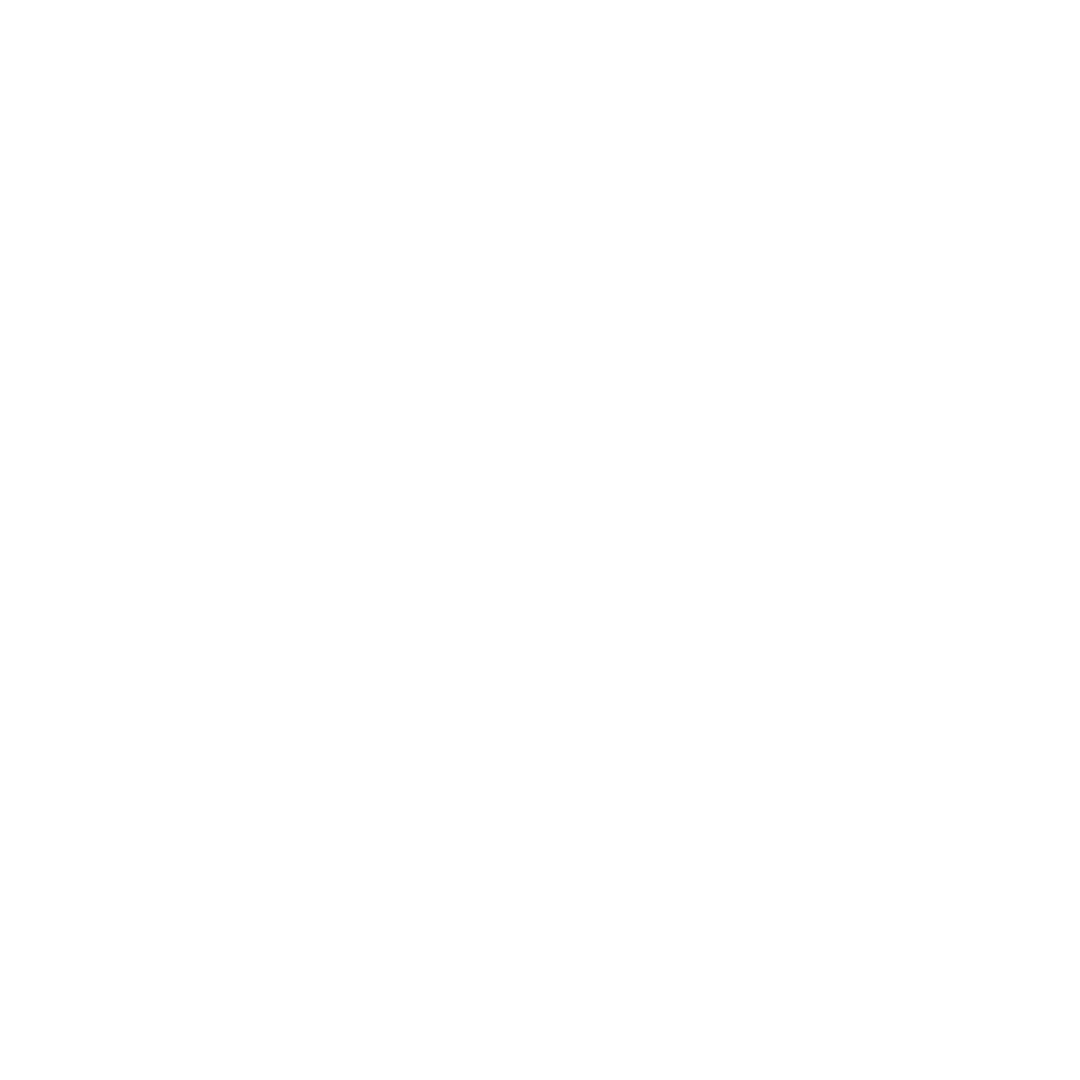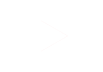Klingt dramatisch, aber für viele kreative Menschen waren Memes mehr als nur ein paar lustige Bilder im Internet. Ich bin mir sogar sicher, dass sie der ausschlaggebende Faktor dafür waren, wer ich heute bin. So ähnlich wie meine Geschichte wird auch die von vielen anderen ausgesehen haben. Also erzähle ich, was mir passiert ist, um zu illustrieren, wie die Meme-Kultur ein Zuhause für die Weirdos einer ganzen Generation wurde.
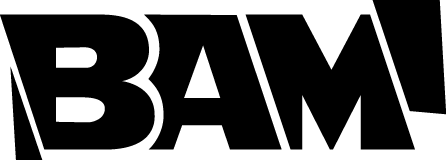
Wir brauchen deine Zustimmung
BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?
Cookie-Einstellungen
Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Alle auswählen
Betriebsbedingt notwendige Cookies
Statistik-Cookiesv
Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv