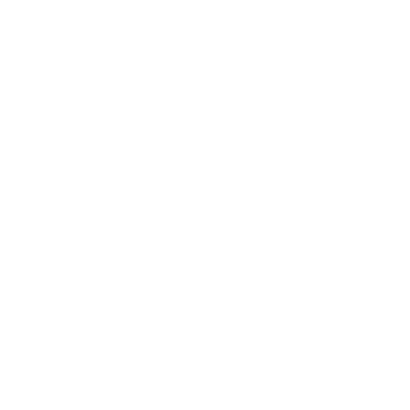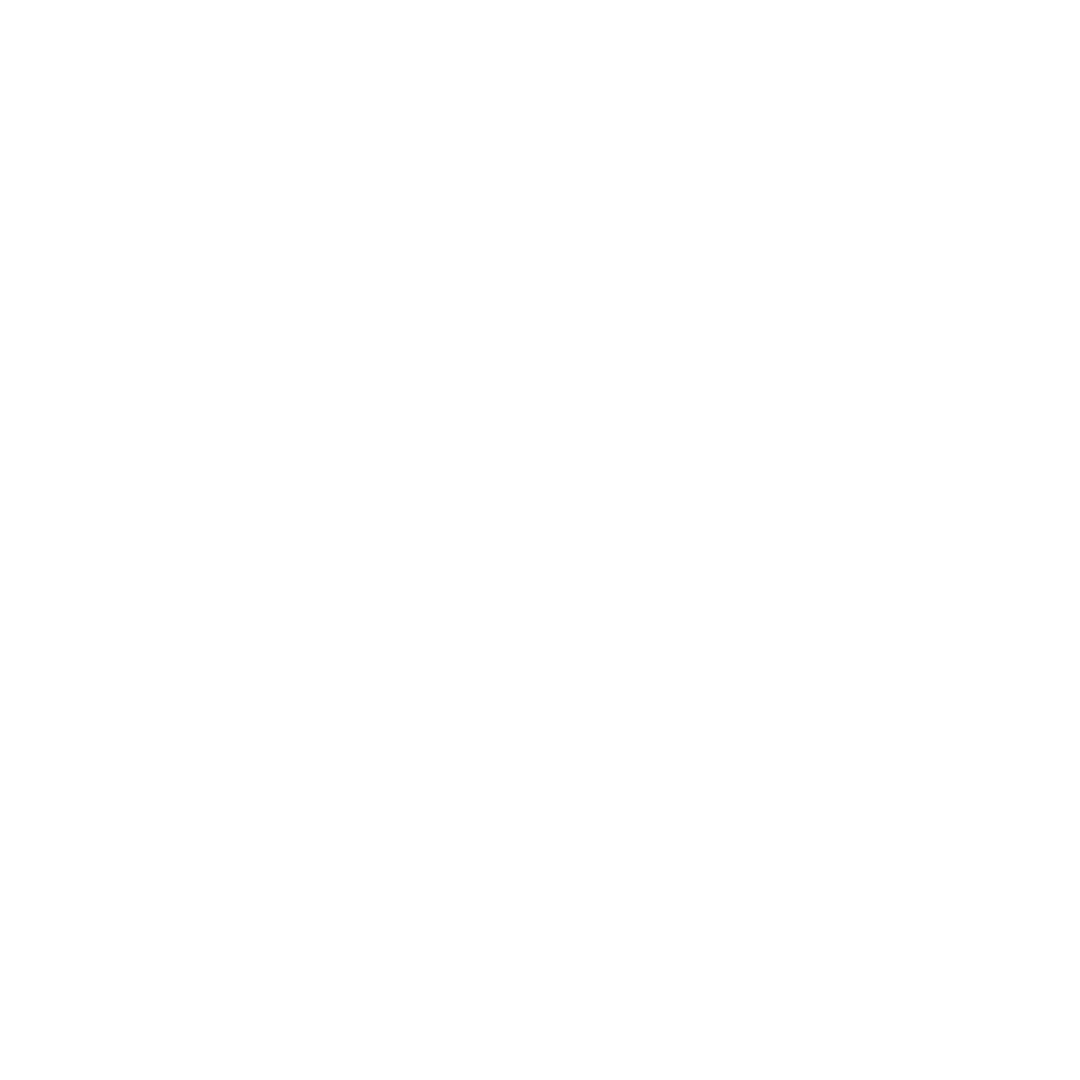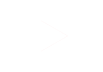Meine erste Erfahrung war die, nicht dazuzugehören. Ich war die, deren Mutter nicht bei den Hausaufgaben helfen konnte, weil sie weder die Sprache gut genug beherrschte, noch die Zeit hatte, zwischen Schichten an meiner Seite zu sitzen und mich anzuleiten. Ich war die, die nicht in die Mannschaft im Sportunterricht gewählt wurde. Essen war meine erste Coping Strategie und ich wuchs früh aus allen Nähten. Ich war die, die nicht die neueste Kleidung trug oder nach den Sommerferien von Fernreisen erzählen konnte., Sommer für Sommer erforschte ich hauptsächlich den Garten meiner Uroma in einem kleinen ungarischen Dorf, wofür sich allerdings niemand aus meiner Klasse interessierte. Später war ich dann die, die nicht mit Freund*innen fortging und das Nachtleben erkundete. Ein ganzes Jahr verbrachte ich stattdessen auf Krücken gehend und war entweder im Krankenhaus oder in meinem Zimmer gefangen. Und als ich schließlich das Schreiben für mich entdeckte, war ich wieder nicht die, die sich in Kunstkreisen etablierte, in einer Szene einen Namen machte, um ernst in meiner wichtigsten Ausdrucksform genommen zu werden.
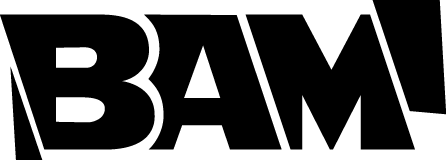
Wir brauchen deine Zustimmung
BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?
Cookie-Einstellungen
Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Alle auswählen
Betriebsbedingt notwendige Cookies
Statistik-Cookiesv
Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv